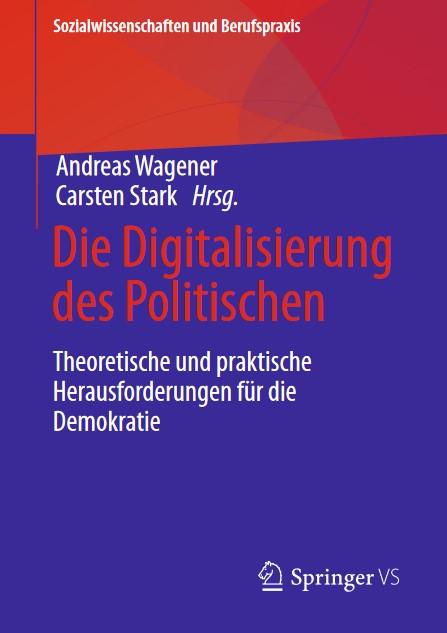Unterrichtsmaterial zu Algorithmen in sozialen Medien
Mal schnell ein süßes Katzenvideo oder ein leckeres Kochrezept bei Instagram teilen? Soziale Medien machen Spaß, vernetzen uns mit anderen und zeigen uns die Inhalte, die uns interessieren. Doch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie oder des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben die dort geteilten Inhalte nicht nur Unterhaltungswert: Sie können eine Quelle der Information aber auch der Desinformation darstellen – alles gestützt durch Algorithmen, die den Nutzer*innen ihre (vermeintlichen) „Lieblingsinhalte“ anzeigen. Dieses intransparente System zu verstehen, erfordert ein hohes Maß an Medienkompetenz, insbesondere für Schüler*innen, für die soziale Medien eine hohe Alltagsbedeutung haben (mpfs, 2022).
Im CIVES-Praxistext #11 finden SoWi-Lehrkräfte hierfür ausgearbeitetes Unterrichtsmaterial, welches als vollständige Unterrichtseinheit oder auch ergänzend zum Schulbuch eingesetzt werden kann. In 3 Unterrichtsstunden à 90 Minuten erarbeiten die Schüler*innen die Frage, was soziale Medien und Algorithmen sind und welche Auswirkungen sie auf die politische Meinungsbildung haben können.
Frederik Heyen, M.Ed. und Dr. Claudia Forkarth haben die Unterrichtseinheit für die Klassen 7 bis 9 an Gesamtschulen, Realschulen und Gymnasien konzipiert. Teile des Unterrichtsmaterials wurden in der Klasse 9 eines Gymnasiums erprobt und im Anschluss hieran noch einmal überarbeitet.
Das Material ist curricular breit verankert (Kernlehrpläne NRW sowie Medienkompetenzrahmen) und umfasst neben einer inhaltlichen und didaktischen Einordnung vollständig ausgearbeitete Stundenverlaufspläne nebst didaktischen Kommentaren, Arbeitsblätter und Kopiervorlagen. Um den Einsatz in (sprach-)heterogenen Lerngruppen zu ermöglichen, enthält das Material außerdem umfassende Differenzierungsmöglichkeiten (z.B. Arbeitsblätter für unterschiedliche Anforderungsniveaus) sowie scaffolds, um individuellen Lernausgangslagen von Schüler*innen gerecht zu werden.
Weitere Informationen zu unseren CIVES-Unterrichtsmaterialien sowie zu allen CIVES-Reihen und bisher erschienen Beiträgen erhalten Sie hier. Alle CIVES-Beiträge erscheinen im OpenAccess, vollumfänglich und kostenfrei.
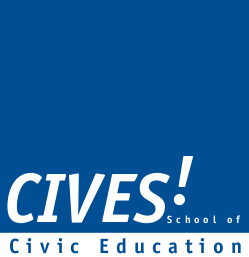
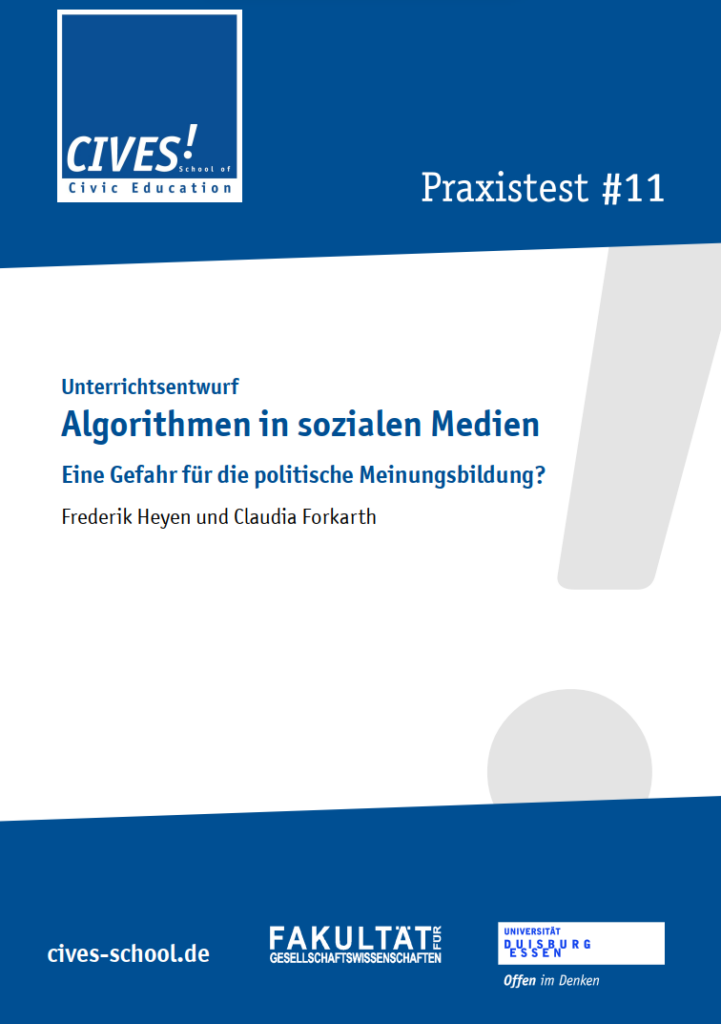











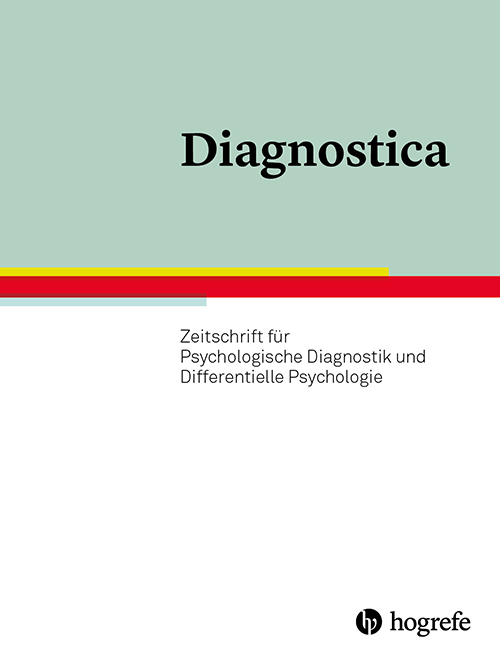



 SchriFT II – Schreiben im Fachunterricht der Sekundarstufe I unter Einbeziehung des Türkischen – Eine Interventionsstudie zur Wirksamkeit von fachübergreifender und fachspezifischer Schreibförderung in kooperativen Settings
SchriFT II – Schreiben im Fachunterricht der Sekundarstufe I unter Einbeziehung des Türkischen – Eine Interventionsstudie zur Wirksamkeit von fachübergreifender und fachspezifischer Schreibförderung in kooperativen Settings